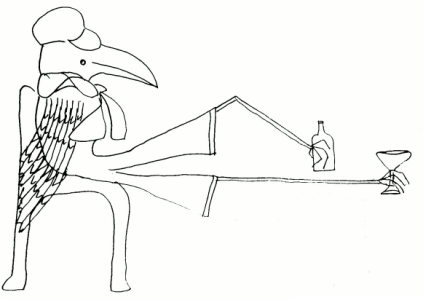
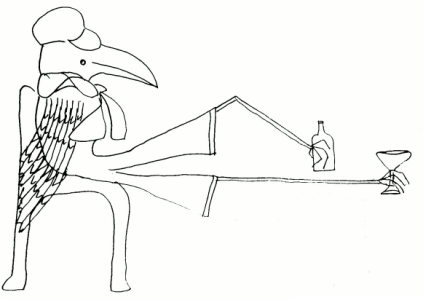
Miriam Loewy
Die schwarze Seife meiner Mutter
„Was sind Eltern?” fragt Ben.
„Zocker”, sage ich, „hirnverbrannte Zocker”. Er sieht mich fragend an, stützt seinen Kopf auf beide Hände. „Sie beginnen ein Spiel, dessen Regeln und Chancen sie nicht kennen. Wer auf dem Sterbebett eine liebevolle Familie um sich versammeln kann, hat gewonnen. Die meisten verlieren. Der Einsatz sind sie selbst. Sie sind das Pfand für unbekannte Größen, angefangen beim Menschen, den sie in die Welt setzen, und geendet in der Welt, die sie für diesen Menschen planen. Sie haben keinen Einfluß, weder auf das eine noch auf das andere. Trotzdem spielen sie.”
Ben ist überrascht. Er hat diese Antwort nicht erwartet. Der Jeton liegt auf dem Spieltisch. Ben erhöht den Einsatz:
„Mensch, was würdest Du ohne Hitler machen, Du kannst ja gar nicht ohne Hitler leben”, sagt er. „Sieh Dich doch um, wo ist denn Hitler?” Ich schweige und sehe ihn an. „Deine Mutter wüßte eine gute Antwort auf diese Frage”, fügt er hinzu. Er hat recht, er hat doppelt recht: Ohne zu zögern hat er den höchsten Einsatz gewählt. Alles oder nichts.
Ich kann nicht sofort antworten. Es ist als ob er mich gefragt hätte, warum ich atme, was doch angesichts der verpesteten Luft sehr unpraktisch und nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja. mein Junge, ich atme, geht es mir durch den Kopf, ich atme und laufe herum und sehe nicht anders aus als andere Menschen und ich fühle Hitler mit jedem Gefühl und denke Hitler mit jedem Gedanken.
In meiner Kindheit in Israel war Hitler allgegenwärtig. Er kommt in unzähligen hebräischen Kinderliedern und -reimen vor.
Wenn wir mit einer Katze spielten, flüsterten wir ihr ins Ohr: „Magst Du Hitler?”, pusteten dabei ein wenig, und schon schüttelte die Katze den Kopf, und wir waren zufrieden. Später wurde mir klar, daß Hitler der Kitt ist, der die israelische Gesellschaft zusammenhält, die von allen geteilte Entschlossenheit, nie wieder wehrlos den Schlächtern ausgeliefert zu sein.
Ben hustet, er wartet auf eine Antwort. Ich bin noch nicht soweit. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich die Worte meines Lehrers im Kopf, der mich gewarnt hatte, jeder Quadratmeter deutschen Bodens sei mit Blut getränkt. Es gibt und gab, Du wirst es nicht glauben, mein Junge, kein kleines beschauliches Dorf und keine Stadt, die ich auch nur einen Tag, eine Minute oder eine Sekunde genießen konnte; da waren sie immer. Ich meine die, die nie gestorben sind, die keine Chance hatten zu sterben, sondern verbrannt, vergast und totgeschlagen wurden. Deshalb gibt es keine individuellen Gedenktage für jeden einzelnen von ihnen, nur kollektive. Ich stehe mit Hitler auf und gehe mit Hitler schlafen. Ben sieht, daß ich noch an seiner Frage kaue, er drängt mich nicht. Ich versuche mich in Hitlers Gestalt zu vertiefen und in mir das gebotene Grauen aufkommen zu lassen, aber es gelingt ihm nicht, dazu gibt er zuwenig her.
Oh, fast hypnotisch versuche ich seinem Bann zu verfallen, auch durch die vielen Dokumentarfilme, die ich fast dazu mißbrauche, um auf den Trip zu kommen, allein er bringt es nicht. Er kann sich drehen und wenden und er dreht und wendet sich, streichelt etwas tapsig ein Kind und schmettert sein Volk an und sein Volk ist eben nicht die deutschen Fischerchöre. Und das Liedgut ist durch die ‘Schwarzbraune Haselnuß’ gekennzeichnet und die Frage ist noch sehr, von wem die orgiastische Kriegswallung ausgeht, von ihm aufs Volk oder vom Volk auf ihn, ich weiß es wirklich nicht und das ist eine der Fragen, auf denen ich hängenbleibe, weil sie grinst.
Ben hat, wie er sagt, Nullbock, die Entsorgungsanstalt meiner Seele zu sein.
Schließlich antworte ich ihm: „Du hast gefragt, wo ich Hitler sehe, ich will es Dir sagen: Ich sehe ihn in den Gesichtern alter Männer und Frauen im Bus und in der U-Bahn.
Er ist in den haßverzerrten Gesichtern der Neonazis, in den abfälligen Bemerkungen über Ausländer; sein Namenszug steht neben den Namen der großen Banken oder Industrieunternehmen, die durch konfisziertes jüdisches Vermögen reich geworden sind. Degussa ist für mich die große Zahngoldschmelze mit den Kzs als Zulieferbetrieben. Hitler zwinkert mir zu, wenn jüdische Friedhöfe geschändet werden oder wenn das Asylrecht preisgegeben wird. Mein Fleischer sagt, er wisse ganz genau, daß Juden Geld küssen. Muß wohl so sein, wenn er es sagt”.
Das Fenster füllt sich mit einem blassen Himmel.
„Und was meine Mutter angeht”, fahre ich fort, „Du hast sicher recht, wenn Du meinst, sie hätte eine gute Antwort gewußt. Es war ihre Spezialität, zu diesem Thema eine gute Antwort zu haben, wenigstens das, da sie doch nichts ungeschehen machen konnte”.
Mein Sohn Ben ist jetzt 33 Jahre alt.
Heute kommt es mir vor, als hätten wir in einer langsameren Welt gelebt, damals, als Ben noch klein war, ein kleiner König, der das Tempo diktierte. Angesichts seiner entwaffnenden Selbstverständlichkeit fiel alle Hektik von uns ab.
Jetzt raste ich aus, wenn er meine Argumente freundlich in den Wind schlägt oder nicht verstehen will, was auf der Hand liegt. Er hat viel in den Wind zu schlagen, weil ich mit Kommentaren nicht spare.
Das Bild ist zu klein oder nicht mittig, ändern Sie die Bildgröße.
Ben ist mit Asterix und Obelix aufgewachsen.
Die Begegnung der Gallier mit den Wikingern scheint für uns in irgendeiner Weise wichtig zu sein. Die furchtlosen Wikinger machen die weite Reise nach Gallien, um die Angst zu erlernen, von der sie gehört haben, daß sie Flügel verleiht. Fliegen wie ein Vogel, das wäre das Höchste.
Die Sache geht schief, der von den Wikingern zum Lehrmeister auserkorene Gallier ist viel zu ängstlich, um ihnen Angst einzujagen, und Angst vor dem Fliegen hat er auch, jedenfalls fürchtet er sich, von dem als Schulungsort auserwählten Felsen zu springen.
Ein scheinbar unauflösliches Patt entsteht. Die fürchterlichen Wikinger verbreiten Angst, empfinden aber keine, der ängstliche Gallier kann keiner Fliege Angst einjagen, geschweige denn den Wikingern. Je gewaltsamer die Wikinger ihr Ziel verfolgen, desto weiter entfernen sie sich von ihm. Schließlich bringen Asterix und Obelix die Sache mit Hilfe des Barden in Ordnung. Seine schreckliche Musik läßt die Wikinger erschauern: Der Keim der Angst ist gelegt.
Die Wikinger springen vom Felsen ins Meer, ihre Flugkünste lassen zu wünschen übrig, philosophischer Gleichmut überkommt den Anführer, der erleben muß, daß aus seinen blutrünstigen Kriegern ängstliche Hasen geworden sind.
Wunderbare Dialoge und Wortspiele ergeben sich aus diesem Mißverständnis, aber auch ein kommunikativer Stillstand, der nicht auflösbar ist, solange die fixen Ideen ein vollständiges Puzzle bilden.
Bewegung kommt erst durch das Nichtkommunizierbare, die unverstandene Musik, in die Angelegenheit.
Natürlich hat Ben dies nie so beschrieben. Aber er ist immer wieder, auch als Erwachsener, auf die Geschichte zurückgekommen und hat sie voller Vergnügen erzählt.
Bens zeitweise blondgefärbtes Haar ist bis auf Fingerdicke abgeschnitten. Die natürliche fast schwarze Farbe ist wieder sichtbar. Er könnte als Rabbi durchgehen mit seinem ernsten Gesicht und seinen forschenden braunen Augen.
Sein nächstes Geschoß trifft mich in die Eingeweide. „Ich möchte friedlich in einer christlichen Gesellschaft leben”, sagt er, ich muß ihn nicht fragen, wer ihn daran hindert, ich weiß, daß ich es bin.
Friedlich? Christliche Gesellschaft? Meint er Verzeihen und Vergessen?
„So, möchtest Du,” sage ich leise, „mir fällt nichts dazu ein”..
„Und Deine Freunde? Wie ertragen sie Dich?” fragt er, nimmt einen Schluck von seinem Tee und zieht seine Schultern ein wenig hoch, Angst vor meiner Antwort simulierend.
„Gute Frage!”, sage ich, „für die bin ich eine Fallstudie, sie können durch mich das Fallen lernen. Für die bin ich die mit der eingebauten Holocaustfalle, ein Gedankenspediteur, zwischen 6 Millionen Juden, die einzeln zu sehen ich mir die Freiheit nehme und manchmal sie auch zeigen, wie Fragezeichen, luftig und nicht zu beweisen für höhnische Leugner.” Er schlürft absichtlich laut. „Es sind zu viele, verstehst Du, zu viele, „fahre ich fort. „Die Idee, ein Volk könnte dahergehen und den Holocaust erfinden, könnte ja geradezu von mir stammen. Aber sofort, gleich hinter dieser Idee krümmt sich die Frage: Warum? Einer Kollektivperversion, einem elendlangweiligen Nachmittag, dem Müßiggang entsprungen? Und gleich dahinter, hör auf zu schlürfen”, brülle ich, „drängt sich noch eine Frage: wozu?
Der Morast dieser Gehirne kann nichts geplant haben, was mich nicht krank macht.”
Die Jagd ist eröffnet. Mein weißes Pferd wird gejagt, meine Ängste werden angefacht, auch mein Tempel wird nicht mehr verschont.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, verständigen Sie bitte unseren Service.
Der Jäger ist ein Rabbi, der sich als Priester verkleidet, mein Sohn.
Ich bin versucht, Ben zu fragen, was Gott am achten Tag der Schöpfung gemacht hat, aber ich fürchte mich vor der Antwort. Als wir ihn gefragt haben, wie er sich die Seele seiner gerade verstorbenen Großmutter vorstellt, hat er, ohne mit der Wimper zu zucken, geantwortet: „Sie ist jetzt ein Doppelwhopper.”
Auf meine Frage, ob er kifft, hat er neulich erklärt:„Na, klar eine Million Autos”.
Bens Gesicht ist von einem dichten schwarzen Bart eingehüllt, der ihn, wie er glaubt, verbirgt.
Wenn er mich besucht, versucht er einen anderen Modus zwischen uns zu installieren.
Einen Standbymodus vielleicht. Keine Hotline mehr.
Sein Vater war ein netter Junge aus einer norddeutschen Kleinstadt, dessen Mutter über mich zu sagen pflegte: ”Ist ja man gut, daß sie keine Negerin ist”. Schon die Tatsache, daß ich diese ehemalige Schwiegermutter bis heute über diesen Satz definiere, geht ihm auf die Nerven.
„Du kannst Menschen nicht auf einen Satz reduzieren, den sie vor 33 Jahren gesagt haben”.
„Kann ich doch!,” zische ich „denn ich habe von der Frau keinen Satz mehr seitdem gehört.” Ich bin zwar keine Negerin, aber ich habe Bens Vater im ersten Monat meiner Schwangerschaft verlassen als er mir beim Frühstück das Salz für das Frühstücksei reichte. Was mich dazu veranlaßte war die traumwandlerische Sicherheit, so und nicht anders handeln zu müssen. Auch später konnte ich nicht mit dem Trost aufwarten, diesen Schritt nachträglich zu bereuen. Dafür erzählt Bens Vater auf gemeinsamen Spaziergängen seinem Sohn, was er für ein Schmerzensmann ist. Ben ist gerecht. Er leidet mit.
Vermeiden Sie Direktblendung und Reflexionsblendung.
Mein cultural code, wie man heute sagt, ist jüdisch.
Es gibt seit geraumer Zeit elementare Wortgefechte zwischen uns, wir bleiben uns nichts schuldig, reden tachless miteinander und schweigen tachless miteinander.
Die geraume Zeit ist räumlich. Ein großes mulmiges Zimmer, dessen Wände aus Jahren bestehen.
Er versucht zu bestimmen, ob ich im OFF- oder ON-modus bin.
Wir waren ein Team, er, ich und Michael, der Mann, der sein Vater wurde, als er zweieinhalb Jahre alt war und den er Hotschiminh nannte, weil wir ihn immer zu den Demonstrationen in den 68er Jahren mitnahmen.
Mit Michael übte er das Klettern auf Bäume, die kleinen Geheimnisse, die Flucht vor meiner übertriebenen Fürsorglichkeit.
Morgens, wenn Michael noch schlief, nahm er Michaels Arm und bewegte ihn wie einen Pumpenschwengel, bis Michael stöhnend „ja?” sagte und Ben ihn fragen konnte, wovon es mehr auf der Welt gibt, Blätter oder Menschen. Oder ob Max und Moritz die Brüder von Struwwelpeter waren, oder wer klüger ist, Männer oder Frauen.
Später nannte er dann Hotschiminh Alterchen.
Als er sieben Jahre alt war, kam er mit der eindeutigen Forderung aus der Schule: „Ich will Horst heißen”. Wir hatten kein Problem damit, jetzt war Ben eine Woche lang Horst, wir achteten drauf, bis er genug hatte.
Unsere einander zugewandten Gesichter sind Monitore mit hochauflösender Grafik, nicht strahlengeschützt.
Unsere Leitungen sind so gelegt, daß Stolpergefahr besteht. Wir sind nicht funkentstört. Seine wütenden Augen sind mein Tribunal.
„Verzeih”, sage ich ihm, „daß ich nicht arisch bin und blauäugig, daß ich nicht im BDM war und mich heute deshalb nicht schämen muß”.
Er kann meine dramaturgischen Fähigkeiten nicht leiden. „Du überziehst, findest Du nicht?”
Die Ein- und Ausschaltung trennt uns nicht von der Netzspannung.
„Nein, das finde ich nicht”, sage ich, „mit deutschem Brauchtum kann ich nicht dienen”.
Bens Pupillen weiten sich: „Das ist es, genau das ist es”, sagt er: „Ich will Weihnachten feiern wie als Kind in Wolfsburg”.
Drücken Sie die Taste 4 um in das Auswahlmenü zurückzukehren.
Seinen Vater und dessen Familie hat er regelmäßig in den Ferien besucht. Bei ihnen hat er oft Weihnachten gefeiert, oder bei Freunden in Wolfsburg.
Ich sehe ihn an. Wahrscheinlich geht ihm die berühmte Weihnachtsgeschichte aus einem alten Micky-Maus-Heft durch den Kopf, in der Onkel Dagobert und Klaas Klever ihren Konkurrenzkampf austragen, indem sie ihren Neffen echte Riesenkräne zu Weihnachten schenken und dadurch in Entenhausen großes Unheil anrichten.
Irgend etwas muß ich versäumt haben, die Luft zwischen uns ist dünn geworden
Mein Gesicht hat keinen Bildschirmschoner.
Ben weicht meinem Zorn nicht aus, er verzeichnet seine Treffer zufrieden.
- Schiffeversenken - blitzt es mir durch den Kopf.
Unbestechlich war er schon als Baby. Keine Kekse von fremden Menschen.
„Als ich schon mal groß war...”, so leitete er seine Erzählungen als 5jähriger ein.
Jetzt wirkt er geballt, obwohl er schmal und sportlich ist.
Früher war ich nicht unsicher und nervös ihm gegenüber, jetzt bin ich es.
Was ist wesentlich, was war wesentlich zwischen uns? Geschichten und Wortspiele? Die Musik? Daß man über alles reden konnte?
„Dein Lachen”, sagt Ben, der mir beim Schreiben über die Schulter schaut.
„Das einzige, was ich nicht akzeptieren werde, ist, wenn Du mit einem Polizeifahrzeug nach Hause gebracht werden würdest”, habe ich ihm ernst gesagt, als er gerade ein halbes Jahr in der Schule war und mir erzählte, daß er und seine Freunde hin und wieder mal etwas mitgehen lassen, im Kaufhaus oder auf dem Markt.
Es war eigentlich keine Mühe da während seiner Kindheit.
Er war ein Geschenk, ein selbstbewußter kleiner Mensch mit eigenen Vorstellungen und Ideen und mit einer ausgesprochenen Unfähigkeit, sich auf Schlägereien einzulassen. Sobald es um physische Kämpfe im Kreise seiner Mitschüler ging, versuchte er sich verbal auseinanderzusetzen und wenn das nicht ging, ließ er sich verprügeln.
„Und was wäre, wenn ich wirklich schwach wäre? fragt er heute.
„Keine Chance”, sage ich, „damit kommst Du nicht durch. Du verleugnest Dich und Deine Fähigkeiten auf eine Weise, die an Hochmut grenzt. Locker mal ein Abi sausen lassen oder eine Lehrstelle großzügig an eine Freundin abtreten, darin bist Du Spezialist. Du bist Dir Deiner so sicher, daß Du nicht im Traum daran denkst, Dich zu vermarkten”.
Ben erspart sich jeden Kommentar.
„Das ist alles?” fragte er in Tel Aviv empört als 14jähriger, als er mich zum ersten Mal in meiner Heimat besuchte, „das ist das Land, von dem Du Dein Leben lang redest?” ganz natürlich fuhr er fort „Sieh Dir den Dreck auf der Straße an!”.
Ich fühlte mich geschurigelt, mein Land wurde kurzerhand von einem Kind abgefertigt, das ich in Deutschland geboren hatte.
Ben hat sich nie gegen mich, gegen uns aufgelehnt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben wir ihm die Möglichkeit, mit uns ernsthaft zu streiten, genommen.
Er grenzt sich jetzt ab. Deutlich.
Er installiert Reibungsflächen. Er will kein Verständnis, keine Nachsicht, er will verdammt noch mal ernstgenommen werden.
Ich stehe auf, hole mir etwas zu trinken, achte darauf, daß mein Gesicht, der Bildschirm meiner Seele, vor starken Magnetfeldern geschützt, stoß- und schlaggesichert ist und ohne geeignete Konsole auf den Schultern bleibt.
Die Konsole hat meine Mutter mit in ihr Grab genommen, nicht nur die.
Nervös dreht sich Ben wieder zu mir, er könnte mit seinem bärtigen Gesicht aus dem Schtetl stammen. Er ist komisch und humorlos zugleich.
Ich erzähle ihm einen jüdischen Witz, Ben sieht mich unbewegt an, als hätte er nichts verstanden.
Er fragt mich unvermittelt, was meine Mutter beruflich getan hat, als sie nach Palästina auswandern mußte. Während ich antworte, wird mir klar, daß Ben nicht zuhört, sondern mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Er unterbricht mich und fragt, ob ich seine Exfreundin Melanie in letzter Zeit gesehen habe.
Ohne die Antwort abzuwarten, schließt er eine Bemerkung über die Rolling Stones an.
Die Fäden der Marionetten haben sich verheddert.
Wenn Erziehung vor allem Nachahmung heißt, hatten wir niemanden nachzuahmen.
Michaels Eltern waren nicht seine Eltern und gingen mit ihm vorsichtig um, nachdem seine Mutter sich das Leben genommen hatte, als er sieben Jahre alt war.
Meine Mutter wandte sich ihrem eigenen Leben zu, nachdem sie mit mir und meiner Schwester nach Deutschland gekommen war und die Mühe der alleinerziehenden Mutter in Israel hinter sich gelassen hatte. Ich war damals 14 Jahre alt.
Musikalisch hat Ben das absolute Gehör.
Während eines Gewitters dürfen Sie die Datenübertragungsleistungen weder anschließen noch lösen.
Ich höre anders als er.
„Du beziehst,” sagt er, „alles was Du hier in Deutschland erlebst, auf die Geschichte mit den Juden, es ist nicht auf die Juden bezogen, das ist längst vorbei, kapier es doch!”
Vergessen, denke ich, die Überlebenseigenschaft schlechthin, funktioniert in diesem Fall nicht. Genauer in diesen Fällen. Es sind zu viele.
„Wie soll ich das Nachtprogramm im Fernsehen verstehen, ohne an die Judentransporte zu denken, wenn zu nachtschlafender Zeit deutsche Bahnen endlos über Schienen fahren, geisterhaft lautlos?” frage ich böse.
In diesem Punkt bin ich ihm noch nie eine Antwort schuldig geblieben.
Ich habe ihm jahrelang tote Juden vor die Füße gelegt, Kinder, Frauen, und Alte. Immer wieder.
Es verdrießt ihn, daß er nicht da zu Hause sein soll, wo ich ihn geboren habe. Er versteht nicht, daß er nur zufällig hier ist, im Exil, in der Diaspora, er muß sich doch in diesem Land so fremd fühlen wie ich.
Als er mit 8 Jahren eine Spielzeugburg mit einer deutschen Fahne bestückt hat und ich ihn gefragt habe, was das soll, hat er geantwortet: „Wir haben gerade gegen die Russen gewonnen.” Wir? Gegen die Russen?
Sein deutsches Wir gegen mein jüdisches Wir, mir stockte der Atem.
„Ich habe Dich nicht als Deutschen geboren”, sage ich, „Du hast genug Geschichtskenntnisse, um Dir vorzustellen, was die Deutschen vor 60 Jahren mit Dir gemacht hätten”.
Er lehnt sich zurück, lacht und sagt: „Es ist doch völlig egal, als was Du mich geboren hast, Japaner, Chinese, Tibeter...”, er läßt die Antwort unfertig in der Luft hängen. „Du bist kein Deutscher, Du bist Jude, ob Du es willst oder nicht”, insistiere ich.
„Würdest Du das bitte mir überlassen,” sagt er höflich, und wenn Höflichkeit bei uns im Spiel ist, sind die Schotten dicht. Ich sehe, daß er schon wieder einen Comic bei sich hat.
Seine profunde Kenntnis der Comicwelt beleidigt mich und ich sage es ihm.
„Warum?” fragt er bestimmt. Ja warum eigentlich? Beneide ich ihn um seine Refugien, die sorglosen kleinen Ecken, in die er abtauchen kann und ich nicht? Die ich hier fremd bin, immer noch?
„Du bist hier fremd, weil Du hier fremd sein willst”. stellt er fest, und ohne es kontrollieren zu können, geht mir Manfred Kanther durch den Kopf, der den staatsbejahenden Bürger als Gegenleistung für die deutsche Staatsbürgerschaft haben will.
Ich kann dem deutschen Staat gegenüber nicht loyal sein. Ich verdanke meine deutsche Staatsbürgerschaft Hitler.
„Daß ich mich hier nie wohl fühlen konnte, das liegt an Dir? An Deiner Mutter? An Deinem Großvater?” fragt Ben mich.
„Und an ihrer Geschichte, an unserer Geschichte” sage ich scharf.
„Du warst nie im Konzentrationslager, wieso schreibst Du darüber?” Er nutzt die Gelegenheit. „Weil ich nicht im Konzentrationslager war”, sage ich „deshalb habe ich die Kraft dazu, ich beschreibe die Lebensbrüche meiner Mutter, die Verzweiflung meines Großvaters”. „Aber es ist nicht Dein Leben”, stellt er nüchtern fest. Seine Augen weichen meinen Augen nicht aus, er ist mir fremd.
Ich hasse ihn, hasse seine Gewaltsamkeit, sehe meine eigene nicht, fange an sie zu ahnen. „Früher”, sagt er „hattest Du eine Obsession, heute hat sie Dich”.
Die Oberkante der Anzeigefläche Ihrer Mimik sollte mit der Augenhöhe Ihres Gesprächspartners übereinstimmen.
Mein Großvater fragte mich, als ich 17 war, warum ich nicht in die Jüdische Gemeinde gehe, in die er nie gegangen ist. Er war Rechtsanwalt und vertrat die Interessen von Shoaüberlebenden gegenüber dem deutschen Staat.
Einen Teil der Akten, der aufbewahrten Vernichtungslisten habe ich gelesen.
Wut und Trauer mischen sich in meinem Mund, meine Sprache gurgelt aus mir heraus, „Du hast recht”, ich ärgere mich über meine Tränen, „es ist so, und es ist in Ordnung so. Als sie noch lebten, konnten sie nicht darüber sprechen, also tue ich es jetzt für sie”.
Er läßt keine Pause zu. „Du bist gefangen und ich will nicht gefangen sein, ich habe damit nichts zu tun und es hat mit mir nichts zu tun”, erklärt er.
Wo sieht er seine Wurzeln? Wie definiert er sich?
Sein erstes Abitur hat er geschmissen. Das zweite Abitur wollte er schmeißen, das auf dem zweiten Bildungsweg, nachdem er sechs Jahre lang Postbote gewesen war, der Freizeit wegen, die einem übrigbleibt bei diesem Job.
Sechs Jahre unterfordert in einem Job, der um 5 Uhr morgens beginnt und um 12.00 Uhr mittags endet.
Ich habe keine Worte mehr, will nicht verstehen, was er mir da sagt, kann es nicht verstehen.
Er ist mit dem Schicksal geschlagen, der Sohn einer Jüdin zu sein, einer in Israel geborenen Tochter und Enkelin aus Deutschland geflohener Juden.
Er will das Diktat der Vergangenheit nicht.
Es ist nichts mehr leicht zwischen uns.
Das meiste ist gesagt. Ich habe ihn zur Freiheit begleitet und kann nicht ertragen, daß er sie sich nimmt.
Meine Zugehörigkeit zu meiner Kultur ist nicht verhandelbar, auch nicht mit ihm.
Seine Zugehörigkeit zu meiner Kultur ist für ihn sehr wohl verhandelbar. Er will verhandeln.
Der Bildschirm ist außerdem mit einer Mutter/Sohn-Schnittstelle ausgestattet, er kann nicht für den optimalen Betrieb der Einstellungen gebraucht werden.
Ich muß respektieren, daß Ben frei sein will und habe nichts als Gift im Gefühl und
die Frage, was das ist: frei sein.
Wird er das Kaddisch an meinem Grab sprechen, wird er andere das jüdische Totengebet sprechen lassen?
Ich stelle die Frage laut.
Er sieht mich freundlich an und schweigt, als würde sich jede Antwort auf diese absurde Frage erübrigen. Er denkt nicht daran, auf meine Frage einzugehen.
Er will keine Fortsetzung sein, er will einen eigenen Neubeginn.
Habe ich ihn indoktriniert? Hat meine Mutter, haben meine Großeltern mich indoktriniert? Ist es eine gute Entscheidung, die er da trifft? Ist es Flucht?
Viermal hat er mich in Israel besucht.
Er kennt Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Stutthof.
„Hitler ist längst nicht mehr das Idol der Rechten”, sagt er. „Was denn sonst?” frage ich schnell. „Na, ihre Landkarte, eine Gebrauchsanweisung”, sagt er ruhig.
Das Wort ‘wir’ aus meinem Mund, kann er nicht ertragen. Wenn ich es wieder benutze, seine und meine Zugehörigkeit beschreibend, habe ich das Gefühl einen schweren, unbiegsamen Pfeil in seine Richtung abzufeuern. Er verdreht die Augen, wenn mein jüdisches „wir” meinen Mund verläßt. „Ein ‘wir’ ohne mein Einverständnis gibt es nicht”, sagt er lapidar.
Gleichgültig ist er nicht, keine Sekunde.
Es geht ums Eingemachte. Meine Geschichtskonserve.
Deshalb wagt der junge Apotheker, bei dem ich Medikamente bestelle, nicht, mir eine Abholnummer zu geben. Er verwahrt meine Bestellungen unter meinem Vor- und Nachnamen, wie es sich gehört. Für meine Spezies gibt es keine Nummern mehr.
In Wirklichkeit war Israel eine Diaspora für meine Mutter.
Für mich ist Israel meine Zu Hause, mein Ursprung.
Für Ben ist Israel ein fremdes Land.
„Sieh es doch einmal von der anderen Seite”, sagt Ben. „Mein Vater hat dasselbe Recht die Vergangenheit zu reflektieren, wie Du. Er hat mit dem Holocaust nichts zu tun. Er hat keine schlaflosen Nächte und er ist nicht so auf Hitler versessen wie Du. Er wohnt in nächster Nähe zu Bergen-Belsen und er kann es wunderbar aus seinem Alltag ausblenden”. Ben nimmt einen tiefen Zug aus seiner Zigarette, er ist angespannt:
„Er kannte Deine Mutter und Großeltern, er mochte sie auch, aber er hatte nie das Gefühl, in ihrer Schuld zu stehen, das hat er mir klar so gesagt. Er ist Lehrer und er geht mit der deutschen Geschichte verantwortlich um”. Ben drückt seine Zigarette im Aschenbecher aus, er zerquetscht sie geradezu.
„Er geht mit der Geschichte verantwortlich um und blendet Bergen-Belsen im Alltag wunderbar aus?” frage ich ruhig, „Wie funktioniert das?”
„Für ihn ist nicht das wichtig, was für seine Eltern wichtig war.”
Jetzt habe ich ihn, denke ich und sage schnell: „Das ist einer der gravierenden Unterschiede zwischen Deinem Vater und mir. Mir ist alles wichtig, was meinen Eltern und Großeltern wichtig war”.
Ben beugt sich vor: „Findest Du das in Ordnung, daß die Eltern vorgeben, was für die Kinder wichtig sein soll?” fragt er sehr beherrscht.
Ich weiche seinem Blick nicht aus.
Um den Datenstau aufzulösen, wählen Sie eine andere Verbindung.
„Es geht nicht darum”, ich versuche meiner Stimme einen festen Klang zu geben, „daß die nachfolgende Generation die Vorgaben der Alten gehorsam wiederkäut. Die Erinnerungen aus der Jugendzeit sind einfach da, Bilder, Gerüche, Ereignisse, wenn sie nicht weggeschoben und ausgeblendet werden.
Das ist das Problem der Deutschen, daß mit der Erinnerung an Bergen-Belsen auch die Geschichten der Großmütter, die Kinderlieder, die Magie eingefroren sind, ebenso wie das eigene und das fremde Leid. Das alles ist nicht verschwunden, es ist unkenntlich geworden, es gärt unter der Decke, ich spüre es, leider.”
„Aber auch Du kannst mit Deinen eigenen Erinnerungen nicht selbstverständlich umgehen”, sagt Ben, „was sind für Dich die Kinderlieder und Geschichten Deiner Großmutter, wenn sie unweigerlich mit Massenmord verbunden sind? Wenn eine wunderschöne Geschichte, die im Schtetl beginnt, im KZ endet?”
„Trotzdem sind die Geschichten meiner Großmutter noch lebendig, die Farben und Gerüche sind noch da, ich möchte, daß Du sie bewahrst und weitergibst”, sage ich.
„Du vergißt”, sagt Ben, „daß Deine Geschichten nicht so enden, wie man sie Kindern vor dem Einschlafen erzählen kann. In allen Deinen Geschichten ist der Tod im Spiel. Ich kann Deine Todesversessenheit nicht ertragen.”
„Das kommt daher”, erwidere ich, „daß Millionen von Mütter, Vätern. Großmüttern. Großvätern, Tanten, Onkeln abgeholt wurden, bevor sie ihre Geschichte zuende erzählt hatten.” „Jedenfalls hat Deine Sucht”, - Ben nennt es wirklich Sucht - „das zusammenzuzwingen, was unvereinbar ist, etwas Gewaltsames und Fanatisches: Lachen und KZ, Tanzen und KZ, Singen und KZ. Ich will lachen, tanzen und singen, ich will das KZ nicht. Du schüttest mir kübelweise Verbrechen und Tod über den Kopf. Laß mich damit in Frieden.” „In Frieden, welcher Frieden denn?” frage ich. „Meine Großmutter hat mir ein sehr friedliches deutsches Lied beigebracht: ‘Guten Abend, Gute Nacht’. Die Zeile ‘Morgen früh, wenn Gott will, wirst Du wieder geweckt’ geht mir jeden Morgen durch den Kopf. Ich bin dankbar, daß ich aufwache, aber ich weiß auch, daß viele, die ihren Liedern das Lied beigebracht haben, dafür gesorgt haben, daß andere Kinder nicht mehr aufgewacht sind.
Das sind die Unvereinbarkeiten, von denen Du sprichst”.
Ich merke, daß ich auf den Tisch geschlagen habe. Ben hält meine Hand liebevoll fest und sagt: „Ich werde nicht als lebendes Mahnmal durch mein Leben gehen wie Du, Deine Großeltern, Deine Mutter.”
Meine Mutter, von meinem Sohn posthum Doppelwhopper genannt, ist 1919 in Celle geboren.
Celle ist laut Lexikon eine niedersächsische Kleinstadt an der Aller im Süden der Lüneburger Heide, 72.000 Einwohner, herzogliches Schloß.
Altstadt mit Fachwerkhäusern. Die Aller ist der größte rechte Nebenfluß der Weser, 262 km lang, mündet in Verden, so steht es im Lexikon.
Dort wurde sie geboren, meine Mutter Eva.
Sie war keine Frau aus Ebenholz, auch keine aus Ecken und Kanten, sie war Ecke, Kante, Ebenholz, verborgen, entblößt, eine Panzerechse, ein Pfau, ein Igel, verfroren, unverfroren, hungrig.
Die Endstation, von der aus sie ihren ganzen Lebensweg noch einmal überblicken wollte, ist eine Wohnung in der trüben Hamburger Innenstadt. Eine dreizimmrige Höhle. Eine Garage für Grandiositätsreste.
Die Durchgänge von Zimmer zu Zimmer sind türlos, die Wände voller selbstgemalter Trauerbilder mit Titeln wie:
„Hamlet auf dem Markt”, „Ohne Ausweg”, „Dorf und Sackgasse”, „Tanzende Katzen”, „Die Klagemauer auf Mallorca”.
Bilder, auf denen leere Gassen zu sehen sind, Gassen, die in Torbögen münden, nicht im Nichts, aber auch nicht im Ziel. Das große Fenster im Wohnzimmer wird durch unzählige Pflanzen verdüstert, wie ein Terrarium.
Alte unbequeme schwere Polstermöbel vom Sperrmüll, hier und dort geflickt; auf jeder Stellfläche ein Glasgefäß mit Wasser, Wasseraschenbecher, in die man im Vorübergehen seine Zigarette werfen kann, und ein kleines Zischen bestätigt: Das Feuer ist aus.
Eine Dufthaube aus Nikotin und Katzenklo stülpt sich dem Besucher über den Kopf. Zeitvergessen die Küche, eine kleine Nische, in der alles verrostet scheint.
Im fensterlosen Badezimmer ein angenehmer Nelkengeruch, ein zu hoch angebrachter Spiegel und ein immer vorhandenes schwarzes Stück Seife.
Der Flur, wie der Seiteneingang eines Waggons; eine von einfachen, großen Mänteln überhangene Garderobe.
Ein stumpfer Spiegel eingebettet in Stellagen, auf denen unzählige Mengen von Kosmetik- und Arzeneiproben verstauben und Perücken, struppig, rothaarig, blond, silbern und braun, wie in einer abgetakelten Schauspielerkabine.
Beim Betreten dieser Bleibe wird die Außenwelt ausgeblendet, verschluckt.
Es war ein psychiatrisches Gutachten nötig, damals, als es darum ging, ihr eine Wiedergutmachung zuzusprechen, in deutscher Mark, einer weltweit geschätzten Währung aus ausgeschlagenem jüdischen Zahngold. Bürger-Prinz hieß der psychiatrische Gutachter des Entschädigungsamts.
Schon sein Name, ein Bürger und ein Prinz zugleich, war ganz nach ihrem Geschmack.
9.125 Tage, 1.330 Wochen, 300 Monate, also 25 Jahre lebte sie mit ihrer schwarzen wohlriechenden Seife, ihrem fensterlosen Badezimmer, ihren Pflanzen und Katzen in dieser Wohnung in der dritten Etage des alten Hamburger Bürgerhauses, in der heute eine junge Familie mit zwei Kindern lebt, die diese Frau nie kennengelernt haben, sie nicht spürten, nicht mit ihr streiten oder auskommen mußten.
Rezitativ und Arie sind fällig. Kein Mensch will die Arie hören, schon gar nicht Ben, mein Sohn.
Es gab gute, ja beste Gründe für die Rückkehr meiner Mutter in das Mörderland.
Schlagende Gründe, simpel und unabänderlich:
Es wachsen keine Birken in Israel, keine Kastanien.
„Du bist ein Daueruser der Geschichte Deiner Vorfahren” hat Ben einmal gesagt.
„Habe ich das wirklich so gesagt?” fragt Ben. „Nein, anders, aber Du hast genau das gesagt”, gebe ich ihm nach. Er widerspricht mir nicht.
Ich lese Ben eine Notiz meines Großvaters vor:„Wiedergutmachung”, lese ich laut, „Wiedergutmachung, Doppelpunkt: Fuchs Du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Wiedergutmachung im deutschen Liedgut.
Es galt Anträge zu stellen, Formulare auszufüllen, Beweise zu erbringen, um den Dieb, Mörder, Raubritter gnädig zu stimmen, damit dieser seinem Opfer einen symbolischen Bruchteil dessen erstattet, was er ihm abgenommen hat. Obwohl man auch hier auf dem Standpunkt stehen könnte”, ich habe den Jähzorn meines Großvaters vor Augen, ”daß der gemeine Deutsche eigentlich vom gemeinen Juden entschädigt werden muß.
Denn wäre der gemeine Jude nicht gewesen, wären die üblen Eigenschaften des gemeinen Deutschen nicht hervorgelockt worden”. Ben sieht mich an, bewegt seine Augen nicht:
„Und dann, bei der Auszahlung der Wiedergutmachung ist es der gemeine Jude, der das Leben, den zerstörten Lebenslauf, das Vermögen seiner Familie im Nachhinein veräußert und seinen Charakter und seine Würde versilbert beim devoten Ausfüllen der vielfachen Anträge, in der Megastunde Null seines Lebens, ein gemeiner Jude eben”.
Er legt seinen Arm um mich. Er ist viel größer als ich. Er geht nicht auf mich ein.
Nicht genügend Platz auf der Festplatte.
Ben will diese Zugehörigkeit nicht mehr.
Die Zugehörigkeit zum Judentum?
Zu den Überlebenden des Holocaust?
Zum Holocaust?
Ich war eine besessene Mutter. Ich war der Schutzschirm und der Rammbock und die Höhle und der Ofen; immer habe ich alles gewußt oder zumindest geahnt und meine Ratschläge hatten oft die Wucht von Meteoriten.
Nie habe ich daran gezweifelt, daß Ben die Kette fortsetzen, seinen Kindern die Geschichte meiner Mutter und Großeltern erzählen wird. Auch sie, seine Kinder, sind ein lebender Beweis dafür, daß Hitler gescheitert ist.
„Man sollte eben nie nicht zweifeln!”, sagt er und lächelt.
Weitere Empfehlungen für die umweltverträgliche Gestaltung Ihrer Kommunikation finden Sie in einschlägigen Broschüren.
Angelegentlich erkundigt sich Ben nach der Familiengeschichte seines deutschen Vaters und seines arabischen Großvaters, unterbricht meine Gedanken aber bald, um auf die Tatsache hinzuweisen, daß der Film Rocky Horror Picture Show doch gar nicht so schlecht war.
Er ist ein Fremder.
Ich starre ihn an, versuche ihn mit meinem Blick zur Ordnung zu rufen. Zu welcher Ordnung?
Warum erwischt er mich so kalt?
„Ich bin eine chronische Jüdin,” versuche ich auf seinen Humor einzugehen, werde aber bitter dabei, „nicht im religiösen Sinn, wie Du weißt, so radikal jüdisch, wie Hitler die Juden gesehen hat, einmal Jude, immer Jude, ob liberal, assimiliert, getauft, strenggläubig oder atheistisch, Itzig bleibt Itzig”, sage ich wütend.
„Der Führer ist Dir osmotisch ins Hirn gedrungen, oder?”
Drücken Sie die Taste 7 - ein Balken erscheint.
Ich fühle mich gefangen in seiner liebenswürdigen Aufmerksamkeit und kann mit seiner Unnachgiebigkeit nicht umgehen.
„Was soll denn das jetzt sein?”, fragt er in einem Ton, der darauf zu verweisen scheint, daß ihm die Batterie ausgeht.
Die empfangene Nachricht war zu lang für die aktuelle Konfiguration.
Installieren Sie die Datei neu.
Ben atmet aus, genervt.
Fremdspannung lastet auf unserer Kommunikation.
Es wird noch sechs Nabelschnüre dauern bis dieses Volk mit meinem Volk wird unbefangen darüber nachdenken können, ob es vielleicht später einmal, sehr viel später möglich sein wird, erste Schritte eines Tangos zu wagen, zu dem, wie man weiß immer zwei gehören. Auf meine Fragen, die wie er vermutet, schon immer die erwartete Antwort enthalten, antwortet er in knappen Sätzen, als sei nur das wert, gesagt zu werden, was in eine Sprechblase paßt: Nein, so stimmt es nicht.
Er versucht mich aus meiner Verbissenheit zu lösen.
Tauziehen.
Er kann mich nicht aus meiner Tradition herausreißen.
Abraham hat Isaak gesagt, wo es langgeht, und Isaak hat Jakob eingeweiht, Jakobs Mutter hatte ihre Hand im Spiel.
Ich bin sicher, daß Isaak die Geschichte mit Esau gemerkt hat, und Jakob gab alles Wissenswerte an Joseph weiter, aber die Namensabfolge sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß es die Frauen und Mütter waren, die dafür gesorgt haben, daß die Kette nicht abreißt, und daß die Väter nur erfahren haben, was sie erfahren sollten.
Es hingen meine ganze Kindheit lang zwei Bilder, Schwarzweiß-Fotos, eine Birke und eine Kastanie in den Zimmern meiner Mutter, wo immer wir in Palästina, später Israel auch wohnten; sie waren der Hinweis auf ihre Heimat und ihre deutsche Sprache, obwohl sie auch andere Sprachen beherrschte, vor allem die Körpersprache.
Der natürliche Tod meiner Mutter in Hamburg war etwas Besonderes für eine Jüdin, das muß betont werden, da funktionierte die Sanduhr nach den Spielregeln der Parzen, sie ist gestorben, sie ist nicht gestorben worden.
Die Augen meines Großvaters: In den Pupillen Massengräber, abertausende Judenskelette in gestreiften Schlafanzügen, verdreckt, verhungert, zahnlos. Deutlich sichtbar jeder einzelne; ein gestreiftes Gewimmel der Ohnmacht.
Und die Augen meiner Großmutter, ausgefüllt mit gelben Davidsternen und Namenslisten, unendliche. Kachelig weiß wird meine Hirn, wie eine Leichenhalle, wenn ich mich auch nur für einen Moment einreihe in die Namenslisten.
Ich bin das letzte Glied dieser Kette; die Verheißung der Väter gilt für mich so relativ wie für alle Mütter, die die Geschicke ihrer Söhne in ihre praktischen Hände genommen haben und die Prophezeiungen den Männern überließen.
„Siehst Du”, sagt Ben ruhig, „siehst Du, wie gefangen Du bist”.
Blitzartig geht mir die Antwort meiner katholischen Freundin Elly durch den Kopf, die sagte, als ich sie fragte, ob sie wirklich glaubt, daß Maria eine Jungfrau war:
„Ich glaube, daß sie eine Jungfrau war, weil ich glauben will, daß sie eine Jungfrau war”. Da sind wir also jetzt.
„Nein”, antworte ich, „ich bin nicht gefangen, ich gehöre dazu, ich könnte ohne diese Zugehörigkeit nicht leben. Diese Tradition ist mein Kompaß”. „Und was ist mit der Tradition Deines Vaters?”, fragt Ben listig.
Treffer.
Schiff versenkt.
Ben ist ein Kulturbastard in der dritten Generation. Meine Mutter hat den Anfang mit ihrem palästinensischen Lover gemacht, mit dem sie zum Entsetzen meiner Großeltern auch noch Kinder hatte, meine Schwester und mich.
Ich habe mir einen deutschen nichtjüdischen Jungen als Vater meines Kindes ausgesucht. Meine Großeltern waren schon abgehärtet und reagierten weit weniger panisch. Ben hat sich eine deutsche Frau ausgesucht, für die das Judentum wohl immer ein Terrain bleiben wird, das man am besten weiträumig umgeht.
Meine Großeltern und meine Mutter waren zu dieser Zeit schon tot, ich bin noch nicht tot.
Ben hat recht.
Tradition wird einem in die Wiege gelegt, aber da kann sie liegenbleiben, bis sie verschimmelt, wenn sie nicht gelebt wird, und ich habe meine Tradition nicht traditionell gelebt, und Ben konnte in sie nicht hineinwachsen. Er war nie in der Synagoge, nie in der Gemeinde. Wir haben die jüdischen Feiertage nie so miteinander verbracht, wie es die Überlieferung vorschreibt, er hatte nur mich als jüdische Mutter, und das mußte nach meiner Meinung genügen. Mußte es wirklich?
Für meine Mutter war ihr Judentum dank Hitler keine Frage, für mich auch nicht.
Das Undenkbare muß gedacht werden: Wird Ben sich anders entscheiden?
Drücken Sie auf Escape, um das Programm zu verlassen.
Meine Argumente sind schwächer als mein Gefühl.
„Daß meine Zugehörigkeit mir nicht selbstverständlich ist, muß wohl an meiner Mutter liegen, oder?”, fragt Ben.
Wieder ein Treffer.
Bin ich verbohrt? Erlaubt er es sich, mir das endlich zu sagen?
Wir sind nicht in der Lage unsere Daten abzugleichen.
Eine Harmoniehure war ich nie, beneidete aber immer die, die ihre Kräfte schonten, ihre Phantasie zügelten, an den Abgründen bremsten um im Lot zu bleiben, auf dem Pfad der Nützlichkeit, des Rationalen.
„Du wirst nur satt, wenn Du mich essen siehst”, sagt Ben freundlich und ruhig.
Eine sehr typische Eigenschaft von der Frau, die man eine jiddische Mamme nennt, denke ich, erspare ihm aber diesen Satz.
Michael und ich haben ihn nicht auf Erfolgskurs getrimmt. Wir haben ihn nicht materialistisch geprägt. Karriere und Geld sind ihm gleichgültig.
Die Dialogfelder flimmern; muß etwas minimiert, maximiert werden um etwas wiederherzustellen?
Ich beneide ihn. Er hat losgelassen. Er nimmt sich die Freiheit, die er hat, und macht mich ungeduldig, weil seine Ruhe ziellos scheint.
Viermal hat er mich in Israel besucht und ein Leben lang Israel in mir...
Trennen sich hier unsere Wege?
„Du glaubst doch nicht wirklich”, sagt Ben ruhig, „daß es für mich nach dem Holocaust noch einen Gott gibt.” Er hält mir seine Zigarettenschachtel hin und sieht mich liebevoll an, als wollte er hinzufügen, „nu, denk noch mal nach”. „Es geht mir nicht um Gott, sondern um unsere Tradition”, sage ich müde, und er stöhnt fast „Tradition, tradieren, wiederholen, soll das alles sein? Gibt es nichts anderes?”
Wollen Sie die Datei wirklich Rückgängig machen?
Verdammt, Erstellen einer Verknüpfung...
Er ist aus unserer Standarddatei geflogen, Versehentlich? Absichtlich?
„Er läßt sich nicht auf Streß ein”, sagt Michael.
Ich verlagere mein Gewicht. Ich schweige.
Erweitere die Liste Deiner Wahlmöglichkeiten, denke ich, klicke auf das gewünschte Element.
Nichts mehr ist selbstverständlich. Die Koordinaten sind verschoben. Verliere ich die Orientierung?
Die Möglichkeit, alles zu verlieren, ist nicht reizlos.
Asterix geht mir durch den Kopf. Die Wikinger haben ihr Ziel erreicht, aber es ist ein anderes als das, was sie sich vorgestellt haben. Ihre neue Erfahrung besteht darin, daß sie nie mehr so sein werden wie vorher. Die alte scheinbar unumstößliche Ordnung ist aufgelöst.
Das Lehrgeld, der hohe Preis, den sie für ihre neue Erfahrung gezahlt haben, ist das einzige, was ihnen bleibt. Sie müssen damit leben.
Nur Asterix und Obelix bleiben unverändert immer dieselben.
Das ist ja der Charme von Comic-Figuren.
ENDE